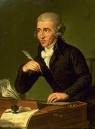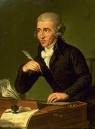
Für ein Konzert mit Sinfonietta Dresden am kommenden Samstag, 7.11.09, 19.30 Uhr in der Dreikönigskirche in Dresden, in dem ferner eine UA von Andreas Kersting und ein Stück der estnischen Komponistin Helena Tulve erklingen, entstand soeben der nachfolgende kleine Einführungstext zu Haydns Sinfonie Nr. 85 in B-Dur, genannt "La Reine":
"Dir, liebe Schwester, schreibe ich zum letzten Mal. Ich wurde soeben verurteilt, nicht zu einem schmachvollen Tod, der nur für Verbrecher gilt, sondern dazu, Deinen Bruder wiederzufinden. Unschuldig wie er, hoffe ich ihm in seinen letzten Augenblicken zu gleichen. Ich bin ruhig, wie man es ist, wenn das Gewissen dem Menschen keine Vorwürfe macht. Ich bedaure tief, meine armen Kinder zu verlassen. Du weißt, ich habe nur für sie gelebt und für Dich, meine gute zärtliche Schwester. Du, die Du aus Freundschaft alles geopfert hast, um bei uns zu bleiben – in welcher Lage lasse ich Dich zurück! Durch das Plädoyer des Prozesses habe ich erfahren, dass meine Tochter von Dir getrennt worden ist. Ach, die arme Kleine! Ich wage es nicht, ihr zu schreiben, sie würde meinen Brief nicht erhalten – weiß ich doch nicht einmal, ob dieser hier Dich erreichen wird. Empfange für sie beide hierdurch meinen Segen. Ich hoffe, dass sie später einmal, wenn sie größer sind, sich mit Dir vereinigen und ganz Deine zärtliche Sorgfalt genießen können. Mögen sie beide an das denken, was ich sie unablässig gelehrt habe: dass die Grundsätze und die genaue Befolgung der eigenen Pflichten das wichtigste Fundament des Lebens sind, dass die Freundschaft und das Vertrauen, das sie einander entgegenbringen werden, sie glücklich machen wird."
Es gibt kaum einen größer denkbaren Gegensatz als den zwischen der freundlichen Sinfonie Nr. 85 in B-Dur von Joseph Haydn – von seinen Zeitgenossen "La Reine" genannt, weil die Königin Marie Antoinette das Werk außerordentlich mochte – und dem grausigen Schicksal der aus Österreich stammenden Maria Antonia Josepha Johanna Erzherzogin von Österreich sowie Prinzessin von Ungarn, Böhmen, der Toskana aus dem Haus Habsburg-Lothringen, später Dauphine und danach Königin von Frankreich und Navarra., guillotiniert am 16. Oktober 1793, also kaum acht Jahre nach Entstehung der Sinfonie und nur neun Monate nach der Hinrichtung ihres Mannes, Ludwig XVI. .
"Wie viel Tröstung hat uns unsere Freundschaft in unseren Leiden verschafft! Und das Glück genießt man doppelt, wenn man es mit einem Freunde teilen kann. Wo aber kann man einen zärtlicheren, innigeren Freund finden als in der eigenen Familie? Möge mein Sohn niemals die letzten Worte seines Vaters vergessen, die ich ihm mit Vorbedacht wiederhole: Möge er niemals danach trachten, unseren Tod zu rächen! Ich liebe ihn..."
Der Auftrag zu den sechs Pariser Sinfonien kam von Claude-François-Marie Rigoley, Comte d'Ogny. Der Comte war Mitbegründer des "Concert de la Loge Olympique", neben dem "Concert spirituel" die wichtigste Konzerteinrichtung in Paris. Dahinter verbirgt sich als Träger eine sehr angesehene und wohlhabende Freimaurerloge, die 1779 gegründete Loge "de la Parfaite Estime & Société Olympique". Ein mindestens zu zwei Dritteln aus Berufsmusikern bestehendes Orchester bestand aus 3 Flöten, je zwei Oboen, Klarinetten, Fagotten, 4 Hörnern, 2 Trompeten und Pauken sowie 14 ersten und zweiten Violinen, 7 Bratschen, 10 Celli und 4 Kontrabässen. Denkbar, dass, wer heute eine Haydn-Sinfonie mit 65 Musikern besetzt, der Opulenz und des Romantisierens bezichtigt würde.
Bereits ab 1764 gab es gedruckte Musik von Haydn in Paris – Sinfonien und Quartette. Nach der Aufführung seines "Stabat mater" wuchs der Erfolg Haydns in Paris. Das Repertoire der Konzerte griff zunehmend auf seine Stücke zurück. 1781 betrug der Anteil seiner Sinfonien 17%, 1782 bereits 39%, im Jahr der wahrscheinlich ersten öffentlichen Aufführungen des Zyklus der Pariser Sinfonien machten Haydns Stücke gar 90%, 1789 84% und 1790 immerhin noch 80% aller aufgeführten Werke aus – ein sensationeller Erfolg. Es gilt als relativ gesichert, dass die Sinfonie in B-Dur wahrscheinlich 1985 beendet war. Die weiteren Stücke in C-Dur, g-Moll, Es-Dur, D-Dur und A-Dur datieren von 1785 und 1786, was im Gegensatz zu Nr. 85 durch Autographe belegt werden kann. Der Verleger Imbault, der die Werke 1788 herausbrachte, war selbst Konzertmeister der 2. Violinen, man spielte in blauen Gehröcken und trug Degen.
"Ich muss zu Dir von einer Sache sprechen, die meinem Herzen sehr wehe tut. Ich weiß, wie dieses Kind Dir Qual bereitet haben muss, verzeihe ihm, liebe Schwester, denk an seine große Jugend und wie leicht es ist, ein Kind das sagen zu lassen, was man will, und sogar das, was es selber nicht versteht. Ich hoffe, ein Tag wird kommen, da es um so besser den Wert Deiner Liebe und Zärtlichkeit begreifen wird, die Du beiden entgegenbringst."
Die sechs Pariser Sinfonien können als erster sinfonischer Zyklus der Musikgeschichte betrachtet werden. Die zwölf Londoner Sinfonien folgten in Haydns eigenem Schaffen; möglich, dass Mozart mit seinen drei späten Werken KV 543 (Es-Dur), KV 550 (g-Moll) und KV (C-Dur, "Jupiter-Sinfonie") den zyklischen Gedanken kurze Zeit später aufgriff, die Tonarten entsprechen jenen der Nummern 84, 83 und 82 des älteren Kollegen. Insbesondere aber zwischen der Nr. 85 in B-Dur und KV 543 gibt es verblüffende Parallelen, die vor allem den ersten Satz betreffen: beide Werke beginnen mit einer Einleitung im Stil der französischen Ouvertüre (mit geschärften Punktierungen und im Adagio alla-breve), beide Sinfoniesätze münden in ein Allegro im Dreivierteltakt, das von einem lyrischen Hauptthema – im piano beginnend – getragen wird. Die Zweiunddreißigstel-Ketten des Adagio kehren im Tutti als Sechzenhntel-Tonleitern wieder – auch dies eine Parallele zwischen Haydn und Mozart. Das, was bei Haydn angelegt ist, wird von Mozart groß ausgebaut: seine Einleitung ist bedeutend länger und mündet in bis auf's Äußerste gespannte Dissonanzen, auch der erste Themenkomplex ist größer ausgebaut. Dennoch ist das gedankliche Gerüst deutlich zu spüren und dasselbe geblieben. Was für die Königin "Grundsätze" und "Befolgung der eigenen Pflichten", sind für die Komponisten die inzwischen fest etablierten Hierarchien des Sonatensatzes …
"Ich muss Dir noch meine letzten Gedanken anvertrauen. Ich hätte sie vom Beginn des Prozesses an niederschreiben mögen, aber abgesehen davon, dass man mir nicht gestattete zu schreiben, verlief er so schnell, dass ich in der Tat keine Zeit dazu gehabt hätte. Ich sterbe im apostolischen, römisch-katholischen Glauben, der Religion meiner Väter, in der ich erzogen wurde und zu der ich mich immer bekannt habe. Da ich keinerlei geistliche Tröstung zu erwarten habe, da ich nicht weiß, ob es hier noch Priester dieser Religion gibt, und da auch der Ort, an dem ich mich befinde, sie allzu großen Gefahren aussetzen würde, wenn sie zu mir kämen, bitte ich Gott von Herzen um Vergebung für alle meine Sünden, die ich begangen habe, seit ich lebe. Ich hoffe, dass er in seiner Güte meine letzten Gebete erhören wird so wie alle jene, die ich seit langem an ihn richte, damit meine Seele seines Erbarmens und seiner Güte teilhaftig werde."
… Grundsätze und Pflichten, die wenig später keinen Heller oder Louis d'or mehr wert sind. Zumindest in der Politik. Die Gerüste des Sonatensatzes brechen etwas später zusammen als jene des absolutistischen Staates (der im Übrigen zunächst von einer grausamen Diktatur auf's Schafott geführt wird). Davon ist bei Haydn wirklich gar nichts zu spüren. Am wenigsten in "La Reine" und gleich gar nicht im zweiten Satz, der als sehr intim bezeichnet werden kann. Das darin zitierte französische Lied "La gentille et jeune Lisette" wird als Romance übertitelt und zum Variationssatz ausgebaut. Insbesondere Flöte und Fagott sind mit Auszierungen betraut. Harsche forte-Kontraste und ein Mittelteil im seltenen es-Moll werfen indessen einen deutlichen Schatten auf das ansonsten eher freche Chanson. Vermeinen wir einen melancholischen Unterton zu erspüren oder deuten wir vor dem tragischen Schicksal der Königin diese Nuance nachträglich ins Stück?
"Ich bitte alle, die ich kenne, und im besonderen Dich, liebe Schwester, um Verzeihung für jedes Leid, das ich ihnen unwissentlich etwa zugefügt habe. Ich verzeihe all meinen Feinden alles Böse, das ich durch sie erlitten habe. Ich sage hiermit den Tanten und all meinen Brüdern und Schwestern Lebewohl. Ich hatte Freunde. Der Gedanke, dass ich von ihnen für immer getrennt bin, und das Bewusstsein ihres Schmerzes gehören zu den größten Leiden, die ich sterbend mit mir nehme. Mögen sie wenigstens wissen, dass ich bis zu meinem letzten Augenblick an sie gedacht habe."
Deftig und durch den typisch lombardischen Vorschlag und Rhythmus durchaus französisch anmutend hebt das Menuett an. In seiner Mitte erklingt ein Trio, das eher von Haydns Heimat Österreich erzählt: Fagott und Violinen beziehen sich deutlich auf alpenländische Folklore, die im zweiten Teil einmal richtig 'hängenbleibt' und erst nach einer Fermate wieder Takt und Ton findet.
Das Rondo ist der einzige Satz, der nach der Eröffnung ohne Wiederholungen abläuft. Geradezu stürmisch jagt das Presto dahin. Die Musikwissenschaft kann sich nicht entscheiden, ob sie darin noch ein Rondo oder bereits ein Rondo in Sonatenform erblicken darf – wir kümmern uns nicht um derlei Schubladen und bestaunen die Fülle der Verarbeitung des Hauptmotivs und seines Kontrapunktes. Vor der letzten Reprise bleibt – wie im Trio des Menuetts – auch hier die Musik hängen und weist an dieser Stelle sogar auf Beethoven voraus, der sich in seiner Eroica sicher ebenso auf Mozarts KV 543 bezieht wie auf Haydns "La Reine", ein Titel, unter dem der Verleger Imbault das Werk bereits bei seiner Veröffentlichung apostrophierte.
"Leb wohl, gute zärtliche Schwester! Möge dieser Brief Dich erreichen! Vergiss mich nicht! Ich umarme Dich von ganzem Herzen sowie die armen lieben Kinder! Mein Gott, wie herzzerreißend ist es doch, sie für immer zu verlassen! Leb wohl, leb wohl! Ich werde mich nun nur noch mit meinen geistlichen Pflichten befassen. Da ich nicht frei in meinen Entschlüssen bin, wird man mir vielleicht einen Priester zuführen. Aber ich erkläre hiermit, dass ich ihm kein einziges Wort sagen und ihn wie einen völlig Fremden behandeln werde."
Nein – wir werden "La Reine" nicht vergessen, wie auch Marie Antoinette sie nicht vergessen konnte: in ihre Todeszelle ließ sie sich ein Spinett kommen, um darauf den zweiten Satz spielen zu können.
Literaturnachweis:
Ludwig Finscher, "Haydn und seine Zeit", Laaber-Verlag Regensburg, 2000
Joseph Haydn, Kritische Ausgabe sämtlicher Symphonien, Vorwort von H. C. R. Landon, UE, Wien, 1963
Wikipedia, "Marie Antoinette", darin zitiert der Abschiedsbrief an die Schwägerin Madame Élisabeth




 Manuel Pujol
Manuel Pujol  Paul Johannes Kirschner
Paul Johannes Kirschner