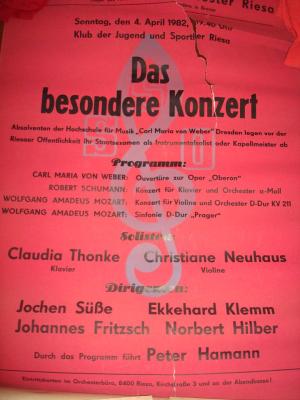Die Dresdner Meisterkurse Musik haben begonnen - untenstehend mein Eröffnungsvortrag. Vorsicht: sehr lang und ausführlich.
Die Dresdner Meisterkurse Musik haben begonnen - untenstehend mein Eröffnungsvortrag. Vorsicht: sehr lang und ausführlich.
Macht Musik?! versus Süße Brühe
Eröffnungsvortrag zu den Dresdner Meisterkursen Musik 2014
In seinem Aufsatz "Gestoppte Gärung" – geschrieben zu Ernst Blochs 90. Geburtstag – schreibt Dieter Schnebel in den Jahren 1974/75 Sätze, die sich auf einen früheren Aufsatz über "die kochende Materie der Musik" beziehen bzw. Gedanken von dort polemisch aufnehmen und fortsetzen:
"Ein Essai über die Formen der heutigen Musik ließe sich kaum mehr mit dem Hinweis auf die gärende Materie schließen – da gärt nicht mehr viel. Nicht als ob die musikalische Materie nun durchgegoren wäre. Eher verhält es sich so ähnlich wie heute vielerorts mit den Weinen: die Gärung wurde gestoppt, und das Ereignis ist jene süße Brühe, deren Fusel einem den Kopf vernebeln."
Schnebel entwirft ein sehr kritisches – und durchaus auch selbstkritisches – Panorama der damaligen zeitgenössischen Musikszene. Alle bekommen ihr Fett weg: Boulez ("akademische Verfestigung"), Stockhausen (Hinwendung zur "intuitiven Musik" für eine "entpolitisierte Jugend mit Hang zu fernem Osten und raschem Rückzug nach innen"), Kagel ("weitgehende Eingliederung seines Œuvres in die offizielle Kultur"), Ligeti ("Fortsetzung der eigenen Tradition"), Penderecki, bei dem es sich ähnlich verhielte. Auch bei sich selbst ließen sich Symptome dieser Art finden.
Das ehrliche und entwaffnende Schlaglicht führt zu im mehrfachen Sinne des Wortes glasklaren Erkenntnissen:
"Daß heute der Fluß der Neuen Musik, genauer: jene Wasser vorne, wo die Musik selbst ihren Lauf bahnt, so kraftlos anmuten, liegt an den Barrieren, die im Wege sind; es sind die einer Gesellschaft, deren Ökonomie immer mehr aus dem Gleichgewicht gerät, und die sich darum zunehmend verhärtet."
Was sollen wir da erst sagen, will es mir einem Stoßseufzer gleich entfahren! Der von Helmut Lachenmann so bezeichnete und mittlerweile häufig zitierte "ästhetische Apparat" zwingt uns mittlerweile, die süße Brühe und noch viel schlimmeren Fusel in jedem Kaufhaus, jedem Lokal – gleichviel, welcher Wein gereicht wird – zu ertragen und wir wären ja froh, wenn wir bspw. wenigstens im Film ab und an mit anspruchsvoller Musik konfrontiert würden, wie sie eine Katharina Blum noch von Hans Werner Henze geschrieben bekam. Mehr noch, eine nicht unerhebliche Zahl derer, die 'kochende Materie' transportieren könnten, werden für entbehrlich gehalten – gut möglich, dass Intendanzen und auch die Musizierenden unter dem Anpassungsdruck mit weichgespülten Programmen ungewollt selbst dafür sorgen, sich (um im Bild des Wassers zu bleiben) überflüssig zu machen: Über die Ereignisse der deutschen Orchesterschließungen und unsinnigen wie unseligen Fusionen habe ich an gleicher Stelle unter dem Stichwort "Musik in der Krise" bereits im letzten Jahr gesprochen, die Situation hat sich seither nicht verbessert, eher weitgehend verschärft. Es soll aber hier nicht zur erneuten Klage ausgeholt werden – der Einstieg mit Dieter Schnebel, dessen Majakowskis Tod ich in München und seine Schubert-Phantasie hier mit dem Hochschulsinfonieorchester in Dresden aufführen durfte, drängte sich beim Nachdenken über unser Motto MACHT MUSIK?! aus vielerlei Gründen auf, die ich hoffe, in den folgenden – sicher weniger wissenschaftlichen als vor allem persönlichen – Überlegungen aufklären zu können. Interessanterweise sind die Anstreichungen in meinem Band der Musik-Konzepte 16 über Dieter Schnebel sehr alt, gehen auf eine von heute aus gesehen durchaus als anders zu bezeichnende Zeit zurück und ich darf meiner vor wenigen Monaten verstorbenen Mutter ein viel zu kleines Denkmal setzen, wenn ich erwähne, dass sie unter Aufbietung erheblicher Nervenkräfte dieses Buch und andere bei ihren durch eine Invalidität möglichen 'Westreisen' im sogenannten Interzonenzug ins damalige Karl-Marx-Stadt schmuggelte. Ein Umstieg mit längerem Aufenthalt in Hannover und ein Musikgeschäft in der Nähe des dortigen Hauptbahnhofes machten es möglich, 1-2 x pro Jahr die nach Ansicht der DDR-Regenten giftige Ware dem Dresdner Studenten mitzubringen und den Zöllnern in Marienborn ein winziges Schnäppchen mit für mich erheblichen Auswirkungen zu schlagen. Auch ein Band über Edgar Varèse und Hans Swarowskys Wahrung der Gestalt waren dabei nebst etlichen Ausgaben der Neuen Zeitschrift für Musik – alles verbotene Ware vom Klassenfeind, daran hin und wieder zu erinnern sollten wir nicht unterlassen.
Aber worin konkret liegt die Macht der Musik begründet?
Lassen Sie uns das Thema beleuchten, indem wir zunächst ein und einfügen: Macht und Musik, ein hochinteressantes und in der Regel brisantes Spannungsfeld, das uns vielleicht einigen Erkenntnissen näher bringt. Gestatten Sie bitte, dass ich dazu versuche, an einem historischen Panorama entlangzugehen und einige besondere Beziehungen herausgreife, um zu verdeutlichen, wie sehr Musik und ihre Schöpfer mit den Mächten der Zeit verquickt, mitunter auch verstrickt sind und darauf reagieren. Die Frage stellt sich, ob nicht gerade aus diesen Auseinandersetzungen Musik ein Stück ihrer 'Macht' gewinnt.
Über Luther und seine Choräle sowie den für Dresden und seine Staatskapelle so legendären Johann Walter muss an dieser Stelle nichts gesagt werden – wir gehen auf ein Reformationsjubiläum zu und ich darf auf jüngst erschienene Studien auch aus diesem Haus gerade zu diesem Thema verweisen. Als Startpunkt unseres Panoramas sollten sie jedoch wenigstens Erwähnung finden, stellen sie doch in vielerlei Hinsicht – und das Bild Dieter Schnebels vom Wasser aufgreifend – eine Quelle dar, aus der der mächtiger werdende Fluss einer Musik gespeist wurde, die gerade in der Reformation ganz besonders machtvoll zur politischen Kraft wurde. Für unser Thema prägend erscheint mir die Erinnerung an ein aus dieser Entwicklung hervorgehendes Ereignis von 1627, mitten im Dreißigjährigen Krieg also.
Man stelle sich vor, es würde heutigen Tags ein Treffen der Präsidenten, Premiers bzw. ihrer Gesandten, sagen wir, von Russland, der Ukraine, Polen, Litauen, Weißrussland, Lettland und Estland geben – könnten wir einen Komponisten empfehlen und welche Musik würde er schreiben? [Gerade eben, am 15.08.2014, lese ich von einem geplanten Treffen zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine in Berlin unter Mitwirkung von Frank Walter Steinmeier – sollten wir Wolfgang Rihm schnell eine Kantate schreiben lassen…?]
Zum Fürstentag in Mühlhausen erschienen sieben Delegationen, die Chefs kamen immerhin aus Mainz und Sachsen, der Rest schickte hochrangige Vertreter. Johann Georg I. aus Sachsen indessen brachte Heinrich Schütz und wahrscheinlich um die 18-19 Musiker mit, die das Treffen vom 4. Oktober bis zum 5. November (wie lang dauert heute eine Friedenskonferenz?...) musikalisch rahmten. Beeindruckendster Beitrag: Schütz' doppelchörige Motette Da pacem Domine, in der einerseits die Vivat-Rufe auf die sieben anwesenden Parteien erklingen, im Mittelpunkt jedoch die Friedensbitte, mit der das Stück auch schließt. Der Osnabrücker Musikhistoriker Stefan Hanheide erläutert uns:
"…im Mittelteil, der die Huldigung beinhaltet, werden immer wieder Partien des Da-pacem hineingesungen, und im Schlußteil des Werkes singen beide Chöre gemeinsam in lateinischer Sprache: Gib Frieden, Herr, in unseren Tagen. Das Werk schließt also nicht mit Hochrufen, sondern mit einer sehr verhalten vorgetragenen Bitte um Frieden. Damit macht Schütz deutlich, daß das Hauptanliegen der Mühlhäuser Zusammenkunft nicht Huldigung der Kurfürsten ist, sondern Schaffung des Friedens. Diese Bitte richtet sich nun aber nicht an die politisch Verantwortlichen, sondern an Gott. … Die Klage über den Krieg und die Bitte um den Frieden war ohne religiöse Dimension nicht möglich. Den Krieg empfand man als eine durch Sünde verschuldete Strafe, und der Friede konnte nur durch Gottes Vergebung dieser Sünde und den Erlaß der Strafe erreicht werden."
Martin Gregor-Dellin beschreibt sogar, dass protokollgemäß die Vivat-Rufe beim Eintritt in die Kirche erklangen sein könnten, während aus der Tiefe des Raumes die Friedensbitten drangen, eine Darstellung, für die Stefan Hanheide keine Quelle kennt.
Es scheint also neben den kompositorischen, kontrapunktischen, melodischen wie harmonischen Künsten viel am Inhalt zu liegen, ob eine Musik mächtig wird. Hören wir einen Moment in die wunderbare Komposition hinein.
Beispiel 1, H. Schütz, Ausschnitt Da pacem Domine
Im Zusammenhang mit unserem Thema wage ich zu resümieren: Schütz' Musik gewinnt Macht aus ihrer
inhaltlichen Verwurzelung, Ernsthaftigkeit, Klarheit und Ehrlichkeit – eine tief inspirierte Kraft aus unerklärbaren
mystischen Elementen kommt hinzu, aber das mag eine subjektive Wahrnehmung sein, nicht zu reden von der handwerklichen Sauberkeit, die im Zeitalter, wo Musik und das Komponieren als Wissenschaft galten, eine Selbstverständlichkeit waren, wenngleich eine, die nicht alle mit gleicher Perfektion und Virtuosität beherrschten wie der Dresdner Sagittarius.
Die Linien des Nachdenkens führen damit unmittelbar zu Johann Sebastian Bach, der sie zweifellos fortsetzt und den wir an dieser Stelle wie Luther und Walter nur streifen wollen, da die Fülle der Literatur inzwischen unüberblickbar geworden ist und an dieser Stelle keine neuen Erkenntnisse hinzugefügt werden können und sollen. Zu verweisen sei etwa auf das von Michael Heinemann herausgegebene Bach-Handbuch, das viele neuere Entwicklungen zusammenführt und beleuchtet – ich stehe nicht an, diesem Kompendium neuesten Bach-Wissens Entscheidendes hinzufügen zu wollen.
Dass auch Bach zwischen Protestantismus und Katholizismus jonglierte, dabei vielleicht nicht mehr ganz so existenziell betroffen war wie der einhundert Jahre Ältere, zeigt der spielerische Umgang mit der Polonaise: Mit dem Blick auf das Königshaus in Sachsen gewinnt der polnische Adelstanz im Werk Bachs besondere Bedeutung und wichtige Stücke, die mit Trompeten und Pauken ohnehin einen König adressieren, sind in diesem Rhythmus angelegt. Besonders repräsentativ ist das neben vielen Instrumentalstücken im Magnificat, in der Kantate Tönet ihr Pauken und damit auch im Eröffnungschor des Weihnachtsoratoriums sowie im Et resurrexit der Messe in h-Moll der Fall – ein Fakt, den viele atemlose Interpreten, auch solche mit starker aufführungspraktischer Orientierung, gern und geflissentlich übersehen.
Wenn wir uns vergegenwärtigen, was einhundert Jahre nach Schütz in der Musik bedeutsam wird, so würde ich hinsichtlich des Leipziger Thomaskantors sagen:
Kreativität, Entwicklung, Struktur, Wissenschaft. Die Kreativität und Experimentierfreude Bachs ist unermesslich und bezieht sich sowohl auf die Erprobung und Erweiterung der Instrumente wie der Spieltechniken und Kombinationen. Der Geist der Entwicklung dominiert von Beginn an das kompositorische Schaffen, es wird in Zyklen, im Geist des Auslotens aller möglichen Varianten gedacht. Je älter er wird, desto mehr gipfelt alles in strukturellen Überlegungen. Stücke wie das 6-stimmige Ricercar oder das erste Kyrie und das Confiteor der h-Moll-Messe stehen singulär und werden als erdachte Strukturen das Universum nach dessen Hinscheiden überleben. Ich sage das so pointiert, weil für mich das Erlebnis gerade dieser Musik (im Falle des Ricercars ergänze ich: In der genialen Fassung Anton Weberns) den Punkt der Wissenschaft mit der schon für Schütz diagnostizierten 'Mystik' zusammenbringt. Sie gewinnen ihre Macht gerade durch die aller Gewaltigkeit entsagende Konzentration auf die u.a. von Georg von Dadelsen diagnostizierte "
Objektivität, Abstraktion und Universalität" . Ein Erlebnis, das mich bei meiner ersten aktiv mitgestalteten h-Moll-Messe im Jahr 1968, ich war 10 und Mitglied des Kreuzchores, sprachlos gemacht hat. Es war nicht das mit Pauken und Trompeten explodierende Gloria und ebenso wenig das bei Mauersberger und später Flämig ohnehin eher pathetisch angelegte Sanctus, das mich zuerst faszinierte, nein, es waren die strukturell erdachten und vergeistigten Stücke, bei denen es Bach wie keinem Zweiten gelingt, dennoch oder vielleicht gerade damit und dadurch in die Tiefe – Achtung: es wird etwas platt – der Herzen seiner Hörer zu dringen. Und völlig egal, ob im Erbarme Dich der Matthäus-Passion Mauersberger mit Gerhard Bosse, Annelies Burmeister und dem Gewandhausorchester musizierten, Martin Flämig mit Walther Hartwich, Heidi Rieß und der Dresdner Philharmonie oder heute Ton Koopman mit Bogna Bartosz und den Amsterdam Baroque Chamber Orchestra – in irgendeinem Winkel hinter dem Lautsprecher oder der Kirchenbank wird wohl immer ein Tränchen verdrückt werden, zu perfekt liegen Idee und Form übereinander, Emotionen auslösend, die in der Tat ans Herz greifen, was immer das in diesem Moment darstellt.
Womit wir zu Mozart kommen müssen, über dessen Beziehungen und Konflikte zur politischen Macht die Musikwissenschaft nach dem Urteil Georg Kneplers lange geschwiegen hat. In seinem 2005 veröffentlichten Buch Wolfgang Amadé Mozart (basierend auf der Erstfassung von 1990) greift Knepler dabei auf Formulierungen eines Hegel-Zitats zurück:
"Es gehört nicht zu den Ruhmestaten der Musikwissenschaft, daß sie so hartnäckig an dem Glauben festhält, der größte Komponist der Zeit gehöre zu den wenigen, die nicht '
mit leidenschaftlicher Bewegung' dem Erfolg der Ereignisse in Frankreich 'entgegenharrten'; er, gerade er, der so scharf Beobachtende und so subtil Reagierende, habe nichts von jener '
erhabenen Rührung', von jenem '
Enthusiasmus des Geistes' verspürt; dem Komponisten des Figaro und des Don Giovanni sei es entgangen, daß man in Frankreich den Adel abschaffte, den er, seit er kritisch zu denken lernte, mit Hohn und Verachtung bedachte."
Mit Christoph Wolffs neuer Auseinandersetzung über Mozart in des Kaisers Diensten und der Diagnose eines "imperialen Stils" wäre dem möglicherweise einiges entgegenzuhalten, jedoch fällt auf, dass Kneplers wichtiges – und übrigens hochgelobtes – Buch in der Literaturaufzählung bei Wolff ebenso fehlt wie jenes von Helmut Perl zum 'Fall Mozart' bzw. konkret zum 'Fall Zauberflöte'. Während Wolff sich ganz der Ausgestaltung der Zauberflöte zu einer neuen Art großer deutscher Oper widmet und mit den vielen phantasievollen und phantastischen Momenten die Macht der Musik im Werk zum eigentlich zentralen Thema erhebt (worüber wir uns ja eigentlich freuen könnten?!), nehmen Knepler und Perl ganz andere Dinge in den Fokus, die uns vielleicht viel besser erklären können, woher der Wind in Mozarts in der Tat großer Oper weht.
Zunächst Wolff: "…der größte Reiz für Mozart mag von einem wichtigen Subtext in Schikaneders Libretto ausgegangen sein, den er zu betonen beabsichtigte: Die Macht der Musik, ein Thema, das ihm von dem antiken Orpheus-Mythos und der christlichen Legende der heiligen Caecilia bekannt war."
Mit Bezug auf die Vorgeschichte und den nachzuweisenden Vorahnungen der Mainzer Republik, mit Bezug auf Mozarts Besuch in Mainz Ende 1790 und der dort ganz lebendigen Mozart-Pflege (übrigens aller italienisch komponierten Opern auf Deutsch!) sowie im Kontext zu enthusiastischen Äußerungen etwa eines Klopstock, Kant oder Wieland zu den Ereignissen in Frankreich entwirft Knepler ein sehr eindeutiges Bild und deutet das in einem Brief an Konstanze beschriebene "andere Bad, … [das] herrlich anschlägt" nicht als eines der medizinischen, sondern der politischen Art. Helmut Perl weist dies fortsetzend nach, dass die Fokussierung auf das Instrument kein Hervorheben der Macht der Musik war, sondern eine Vorsichtsmaßnahme gegenüber den Maßregeln und Vorschriften der Zensur (vom 13. Juli 1781): "Der Titel Zauberflöte signalisierte ein 'artistisches' Libretto mit harmlosem Inhalt." Der harmlose Inhalt indessen stellt sich als einer dar, bei dem die drei Damen als Kapuzinerinnen – die Kapuziner waren die Hauptträger der Gegenreformation – und die Königin der Nacht als Symbol der Mutter Gottes erscheinen: "Die sternflammende Königin … stand beispielsweise im Hochaltar der Franziskanerkirche in Salzburg in einem barocken sternförmigen Strahlenkranz; die spätgotische Madonna in einem Bild wurde durch den Begriff 'sternflammende Königin' beim Publikum sofort evoziert." Die katholische Kirche galt unter Joseph II. als Institution, die viel verspricht aber wenig tut – reihenweise wurden Klöster geschlossen: Ein Weib tut wenig, plaudert viel stellt also keinesfalls Frauenfeindlichkeit dar (bei Mozart ohnehin schlecht nachzuvollziehen) – es war die katholische Kirche gemeint. Der Name Papageno gehe darauf zurück, dass sein Träger jener sei, der den Papa, also den Heiligen Vater ohne zu hinterfragen nachplappert, Papageno als der, der sich vor Wissen und Denken fürchtet usw. usf. – es können und müssen die vielen Indizien aus Libretto, zeitgenössischen Bühnenbildern und anderen Verweisen, die Perl anführt, hier nicht wiederholt werden, das Fazit ist von Interesse und geht in eine andere Richtung als das von Christoph Wolff. Perl sieht als das zentrale Thema der Zauberflöte "die Mündigkeit bzw. Unmündigkeit des Menschen. … Die persönliche Reaktion der Personen der Handlung ist dabei in der Zauberflöte keine individuell-charakterliche, sondern eine gesellschaftstypische. Jeder Zuschauer konnte sich mit seinen Denkmustern oder Vorurteilen in irgendeiner Person des Spiels wiederfinden." Soweit Perl, der schlussfolgert, Kirche und Staat hätten diese moralischen Positionen weder verstehen noch tolerieren können.
Und dabei war bisher noch nicht einmal von den Frauen die Rede, denen Mozart in seinen Stücken – von Ilia angefangen über Konstanze, Contessa, Donna Anna und Elvira bis hin zur Fiordiligi und Pamina – stets die seelenvollsten Klänge zueignet. Auch in der Zauberflöte kann wohl jenes Stück mit der heiligen Zahl Nummer 7 als besonders seelenvoll gelten, das Mann und Weib und Weib und Mann an die Gottheit heranreichen sieht (interessant: Nicht an Gott, sondern die Gottheit!). Kalt dagegen ist die Seele der Königin, die eine Bravourarie im sakralen Stil der Zeit erhält mit Recitativ, langsamem Teil und funkelnden Koloraturen – nach Helmut Perl im Kostüm und Bild der Mutter Gottes auftretend eine Gotteslästerung, die nach der Justizreform von 1787 höchst angreifbar war.
Berühmt wurde die Zauberflöte nicht durch Libretto und Bühnenbild, sondern durch die Macht der Musik eines gewissen Mozart, der den Intentionen kongenial folgt und sie mit
Phantasie, Leidenschaft, Seele und dem oben von Hegel bereits zitierten "
Enthusiasmus des Geistes" ausstattet, womit wir unsere Liste wichtiger Ingredienzen für eine machtvolle Ausstrahlung der Musik weiter verlängert hätten.
An dieser Stelle müssen wir ein sehr konkretes Beispiel zweier Ouvertüren einfügen, um einen wichtigen Aspekt herauszuarbeiten, der mit Beethoven die Musik ergreift. Es ist jener des
Idealismus, der
Genialität, des
Experiments und eines nach innen wie außen
revolutionären Ansatzes. Nach innen verlagert vielleicht am deutlichsten in den späten Klaviersonaten und Quartetten, nach außen jedoch ganz deutlich in der zuerst komponierten der Leonoren-Ouvertüren, jener mit der Nummer 2, die sich am 20. November 1805 französische Offiziere statt des größtenteils geflohenen Wiener Publikums in einem halb-leeren Haus anhörten, ein programmierter Misserfolg. Beethovens idealistischer Stoff und Herangehensweise, seine revolutionären musikalischen Ideen und sein genialisch experimenteller Geist waren eine Zumutung und konnten nicht anders als missverstanden werden. Dies wird besonders deutlich durch die Umarbeitung der Ouvertüre Leonore II zur Leonore III, die ein Jahr später einer Aufführung vorangestellt wurde. Ganz klar hat sich Beethoven hier bemüht, den scharfen Kristall der Erstfassung abzuschleifen: Das Stück ist – wie Robert Maschka in einem Aufsatz im Beethoven-Handbuch nachweist – konzentrierter, teilweise knapper und durch eine klarere Reprisenstruktur möglicherweise besser zu rezipieren. Was dabei allerdings ein Stück weit verloren geht, ist der atemberaubend neue Ansatz, den man übrigens als Dirigent schon spürt, wenn man die Ouvertüre zu dirigieren beginnt mit ihrem zweimal anhebenden fortissimo-Schlägen (in Leonore III nur einer) und danach eine knappe Viertelstunde Sinfonie interpretiert, ehe der Vorhang sich hebt – einen solch revolutionären Ansatz für eine Oper hat sich nach Beethoven keiner mehr gewagt, weder Wagner noch Verdi, allenfalls Schumann in der Genoveva. Dann kommt jene Stelle, bei der das gesamte Orchester in As-Dur anlangt, das mit rasanten Tonleitern der Streicher durchmessen wird. Wir sind im Adagio, in Achteln musiziert, vielleicht ca. MM = 60 (um unsere Berechnung etwas einfach zu gestalten. Es folgen
- ein Akkordabschluss auf Eins und fünf Achtel Pause,
- ein zweiter Anlauf As-Dur mit Abschluss auf einem verminderten Akkord und fünf Achtel Pause,
- zwei einzeln stehende Akkorde auf Eins mit wiederum jeweils fünf Achteln Pause
- schließlich ein Takt mit drei Akkorden, die den dominantischen Überleitungsteil zum Allegro einläuten.
Mit Verlaub, das ist solcherart unzumutbar wie gleichermaßen genial: In den beschriebenen sieben Takten zwingt Beethoven seinen Hörern bei dem angenommenen Tempo in 42 Sekunden 23 ewige Sekunden Stillstand auf – das konnte nicht gutgehen und kann dennoch als eine der tollsten Erfindungen aus seiner Feder gelten.
Nun aber Leonore III, was wird aus dieser Stelle? Sie ist zu vier Takten geschrumpft und die Pausen sind komplett mit nachklingenden Bläserakkorden gefüllt – eine Stelle, die ich vor Kenntnis und Dirigat der Leonore II immer als besonders apart empfunden hatte, mit der ich seither jedoch ein akutes Problem habe… Der schroffe, revolutionäre Beethoven von 1805 ist das Original und die Macht seiner Musik bezieht sich just aus dieser Kompromisslosigkeit.
Beispiel 2, Beethoven Leonore III Takt 27 – 30 und Leonore II Takt 36 - 43
Kein Wunder, dass nach solchen Eruptionen eine Beruhigung angesagt war und das 19. Jahrhundert zunächst zu Kontemplation, mit Schubert und Schumann und dem Lied zur
Lyrik, Melancholie, Einsamkeit, auch zum schon 1782 bei Johann Abraham Peter Schulz erstmals so bezeichneten
"Volkston" und mit Wagner schließlich zum
Phantastischen und
Mythologischen neigte, die Explosionen sich nicht vordergründig im Material, sondern mit Liszt, Chopin und anderen sich eher auf dem Feld der
Virtuosität abspielten. Sie merken, dass ich einen großen Sprung mache und das gerade für unser Thema 'Macht und Musik' so interessante Spannungsfeld der Dresdner Ereignisse um Wagner und Schumann von 1849 ausblende – hierzu ist in den vergangenen Schumann- und Wagner-Jahren 2010 und 2013 viel geforscht und gesagt worden.
Aber gestatten Sie mir ein wichtiges und oft übersehenes Detail zu erwähnen im Hinblick auf eine Entwicklung, die mir bedeutsam erscheint und den Schritt ins 20. Jahrhundert vielleicht überraschenderweise von dem oft als glatt apostrophierten Mendelssohn ausgehen lässt – wir wissen um die antisemitischen Hintergründe solcher Vorwürfe. Die Rede ist vom Gegensatz zwischen einem 'demokratischen' und einem 'autoritären' Ansatz des Komponierens und Musizierens.
1829, also bereits mit 20 Jahren, führte Mendelssohn die Matthäus-Passion Bachs auf und leitete damit einen Prozess ein, der letztendlich im bürgerlichen Konzertbetrieb mündete und als dessen entscheidender Anstoß gesehen werden kann. Es begann damit auch die 'Erbepflege' – mit den Konzerten unter Mendelssohn beginnen die Konzertprogramme, sich an Musik vergangener Generationen zu orientieren. Auch diese eine Fußnote im Kontext von der Macht der Musik.
1836 kommt es zur Uraufführung des Paulus und kurze Zeit später schreibt Mendelssohn an seinen Freund Klingemann: "Und jetzt im Augenblick sind die Singvereine gut und sehnen sich nach Neuem" – der auslösende Impuls zur neuerlichen Beschäftigung mit einem Oratorium. Martin Geck bestreitet indes, dass Mendelssohns Interesse für die Singvereine einzig dem Erfolg galt und konstatiert: "Indem er das Chorwesen fördert, will er der Gesellschaft dienen. Wie er einem Leipziger Beamten im Zusammenhang mit der Gründung des dortigen Konservatoriums am 8. April 1840 darlegt, haben Künstler die Aufgabe, der 'vorherrschend positiven, technisch materiellen Richtung der jetzigen Zeit' den 'ächten Kunstsinn', das heißt den 'Sinn für das Wahre und Ernste' gegenüberzustellen." Im gleichen Zusammenhang sind die meisten der Initiativen Mendelssohns zu sehen, angefangen von den in Berlin im elterlichen Haus veranstalteten Hauskonzerten (mit teilweise beinahe 300 Gästen) über die dirigentische Tätigkeit und die Leitung vieler Musikfeste in Berlin, Düsseldorf, Aachen, Köln, Frankfurt, Leipzig, London und anderswo bis hin zum Einsatz für das Leipziger Konservatorium oder die Berliner Akademie der Künste – letzteres ein Traum, der nicht in Erfüllung ging. Bei all diesen Plänen, Ideen und ungezählten Auseinandersetzungen ging es um
Öffnung, Liberalisierung und Demokratisierung der Kunst und speziell der Musik. Sie sollte gerade daraus neue Macht gewinnen.
Bis in die Kompositionen hinein lässt sich dieses Bemühen verfolgen. Rainer Riehn notiert in Band 14/15 der Musik-Konzepte: Der Komponist hebe gerade hier die herrschaftsabbildende Dichotomie zwischen melodieführender Stimme (als Träger des Diskurses) und Begleitung auf. "Mendelssohn bringt das 'Unterdrückte' – hier durchaus in mehrfacher Interpretation des Begriffs … zu verstehen – nach 'oben': das, was früher nur Folie war. Es gibt in seinem Orchestersatz keine Stereotypen, keine bloßen Füllsel mehr, er ist vielmehr aufgebrochen, so kunstvoll die sekundäre Politur ihn wiederum glättet." Geck, Riehn und übrigens auch Hans Mayer thematisieren von hier ausgehend Mendelssohn als sehr widersprüchlichen Künstler, der es nicht darauf anlege, sein Publikum zu provozieren, sondern es für die Kunst einzunehmen. Sein Spätwerk weise in eine Richtung, die neue Dimensionen erahnen lasse.
Dimensionen, die anderen Generationen vorbehalten blieben. Den großen Sprung hatte ich bereits angekündigt und so sehen Sie mir bitte nach, wenn wir Brahms, Wagner und auch Bruckner und Mahler oder Debussy an dieser Stelle übergehen. Die völlige Aufhebung von Melodie und Begleitung, einhergehend mit der Aufhebung harmonisch hierarchischer und aufeinander bezogener Tonarten blieb dem 20. Jahrhundert vorbehalten – ein neuer Geist weht in jedwede Richtung und entfesselt rhythmische (Stravinski), formal und tonal völlig freie (Varése) und natürlich auch instrumentale Kräfte, die Gewalt des neuen Jahrhunderts geht einher mit der Etablierung des Taktwechsels, des Schlagwerks, der Atonalität und später der Elektronik. Im Untergrund verborgen wie die Idee vom "ewigen, einzigen" und "allmächtigen" Gott ordnet Schönberg in seinem 'opus summum', der unvollendeten Oper Moses und Aron das gesamte Stück einer einzigen Zwölftonreihe unter und entwirft mit dem Beginn des Werkes, bei dem Moses die vielfach aufgeteilte Stimme Gottes aus dem brennenden Dornbusch vernimmt, eine klanglich, melodisch, rhythmisch wie harmonisch faszinierende Szenerie, komponiert Anfang der dreißiger Jahre, also noch vor den desaströsen Ereignissen danach.
Beispiel 3, Schönberg, Moses und Aron, Beginn
Die Kantate Ein Überlebender aus Warschau bildet dazu einen zeitlichen Rahmen, sie entstand nach dem 2. Weltkrieg und dem Holocaust im Jahr 1947 und knüpft stilistisch an den Moses an. Erstmals kann davon die Rede sein, dass die unfassbare Gewalt und Bosheit einer Epoche in der Musik mächtig wird – das Stück wurde zu seiner Uraufführung nach einer Schweigeminute wiederholt und erntete danach großen Beifall. In ihrer Einführung beim Arnold-Schönberg-Center Wien zitiert Therese Muxeneder die Worte Luigi Nonos: "Dieses Meisterwerk ist aufgrund seiner schöpferischen Notwendigkeit des Verhältnisses Text - Musik und Musik - Hörer das ästhetische musikalische Manifest unserer Epoche."
Die
geistige Idee in Verbindung mit der
Struktur des Materials kann wohl als die entscheidende Macht dieser Werke betrachtet werden und Nono selbst fügt dem das konkrete politische Engagement hinzu: Ganz persönlich als Mitglied der kommunistischen Partei Italiens und kompositorisch in vielerlei Schattierungen bis hin zur La fabbrica illuminata von 1964, die die Alltagsrealität einer Fabrik und Alltagstexte zum musikalischen Material erhebt. Jürg Stenzl schreibt in seiner Monografie, Nono habe nun nicht mehr nur Zeugnis ablegen sondern direkt eingreifen wollen und zitiert ihn mit den Worten: "Ich sehe wie nötig es für uns alle ist, alles direkt zu kennen, zu prüfen, zu verstehen. Man sieht danach klarer und konkreter, man ist weniger abstrakt und theoretisch. Aber es ist eine sehr schwere Probe."
Zuvor war die Intolleranza 1960 entstanden, die an Schönbergs Survivor anknüpfend dokumentarisches Material verwendet, Schlagzeilen, aktuelle Ereignisse, aber auch Lyrik bspw. von Ripellino, Majakowski und Brecht und das Schicksal eines Gastarbeiters thematisiert, der in seine Heimat zurückkehren will, in Friedensdemonstrationen gerät, verhaftet und gefoltert wird. Mit einer neuen Gefährtin kommt er nach Hause, das Dorf wird von einer Hochwasserkatastrophe verwüstet, am Ende bricht der Damm und das Wasser reißt alles mit sich. Die letzten Worte der beiden: "Hier muss man bleiben, hier alles ändern".
Ein Ausschnitt des Beginns und der Verhörszene.
Beispiel 4, Nono, Intolleranza 1960
Konrad Boehmer, als 20-jähriger Student bei der Kölner Aufführung 1962 dabei und Assistent, berichtet über die Situation der beiden Parteien aus "Musik-der-Zeit"-Anhängern (einer Konzertreihe des WDR) und der von ihm als "Philistern" der Oper bezeichneten Fraktion: "Als dann Nono in die Oper einbrach war es, wie wenn Gregor Gysi Angela Merkel öffentlich auf einem CDU-Parteitag knutschen würde. Die Kölner Oper war damals heiliges Terrain der Philister. Wegen Nono drangen die Fortschrittler dort ein. Die Philister waren doppelt beleidigt: wegen der 'modernen' Musik und wegen der politischen Botschaft. Daher die heftige Konfrontation, die ich als sehr erfrischend empfand. Was waren das für Zeiten, da Musik die Menschen noch so berührte, daß sie sich die Kehlen heiser brüllten."
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind im Heute angekommen. Nono starb 1990, der anfangs zitierte Text von Dieter Schnebel datierte aus den Jahren 1974/75. Bitte gestatten Sie mir noch zwei Abschweifungen und zunächst eine Entschuldigung und Erklärung, bevor ich auf Schnebel zurückkomme.
Die Entschuldigung: Es fehlt in meinem Panorama sehr sehr viel und es könnte womöglich der Eindruck einer Einseitigkeit entstehen, sowohl was die Provenienz der ausgewählten Komponisten als die Stilistik betrifft – die Macht der Musik und dessen, woraus sie sich speist wäre genauso mit Beispielen aus dem Jazz zu diskutieren. Bitte um Gnade, auf diesem Gebiet kenne ich mich als Dirigent einfach zu wenig aus und würde niemals wagen, Bündiges dazu zu sagen – es ist auf dem eigenen Feld schon schwer und gewagt genug.
Die erste Abschweifung: Die Antithese. Ihr müssen wir natürlich nachgehen. Es gibt seit einiger Zeit ein Buch unter dem etwas knalligen und effektvollen Titel "Böse Macht Musik" , Ergebnis eines Symposiums. Diskutiert werden, wie es im Vorwort heißt, Ansätze zu einer "Ästhetik des Bösen in der Musik". In einem "Versuch über das Anorganische in der Musik" schreibt da etwa Nina Noeske: "Bis heute ist die Auffassung verbreitet, dass es sich allein dann um ein 'großes Werk' handeln könne, wenn dessen Bestandteile wie aus einem Guss entstanden erscheinen. … Das Deutsche, die Seele, das Tiefe, das Organische, das Schöpferische: Es ist kaum von der Hand zu weisen, dass diese Kategorien im 19. Jh. zusammengehören. Hinzuzufügen wäre: Auch Goethes Faust ist ein prototypischer Deutscher. Hieraus ergibt sich zugleich das Gegenbild: das Französische, das Intellektuelle, das Ironische, das Mechanische, das Seelenlose und Zerstörerische; kurz: Mephisto."
Das sind zweifellos Fragen, die gestellt und diskutiert werden müssen, erst recht unter dem Aspekt der Überwältigungsstrategien, transzendentaler Effekte und der Banalisierung, die Beate Kutschke in ihrem Aufsatz über "Imagines 'böser' Musik" thematisiert. Sie geht dabei u.a. der Frage nach, wie der Wagnersche Walkürenritt zum faktischen und fiktionalen Soundtrack kriegerischer Handlungen werden konnte, bspw. in Coppolas Helikopter-Angriffsszene von Apocalypse now und endet konsequenterweise bei der Nutzung von Musik als Waffe und Folterinstrument. " Heavy Metal, Hard Rock und Rap sind für die Soldaten gut, weil sie dazu dienen, sich selber psychisch auf einen Einsatz vorzubereiten … und weil sie zugleich dazu eingesetzt werden können, die Feinde, d.h. die Angegriffenen oder Verhörten, zu schwächen. Die stundenlange und extrem laute Beschallung mit der ausgewählten Musik schädigt nicht nur das Gehör, sondern demütigt zugleich auch diejenigen, die die jeweils gespielte Musik und die davon repräsentierte Kultur ablehnen." Sie bezieht sich abschließend auf einen Aufruf britischer Musiker und Musikwissenschaftler, die darauf drängten, den Missbrauch von Musik als Waffe im Krieg und für Folter zu beenden. Sie gingen implizit von der Gefahr aus, "die mit dem Missbrauch von Musik als Waffe und Folterinstrument verbunden ist: dem Verlust des positiven kulturellen Wertes, den Musik bisher besaß und, damit verbunden, dem Verlust der Musik als Kulturgut generell. Das 'böse' Image, dass Musik, insbesondere klassischer Musik, seit 1945 zugeschrieben wird, scheint sich in den neuen auditiv orientierten Kriegstechniken verselbständigt zu haben."
Das böse Image klassischer Musik? Das bleibt einem nun doch etwas im Halse stecken – wir sollten uns aber nichts vormachen, es sind die gleichen Intentionen, die heute dazu führen, Orchester, Theater und Musikschulen mit Kürzungen, Schließungen und Fusionen zu belegen und die Katze beißt sich sprichwörtlich in den Schwanz: Es ist der vorhin im Zusammenhang mit Nono zitierte Konrad Boehmer, der 1970 mit einem revolutionären Aufruf der "Sozialistischen Zeitschrift für Kunst und Gesellschaft" Musikausübung und Musikausbildung kritisierte und die "von vorneherein vollzogene Programmierung der jungen Musiker im Hinblick auf ihre spätere partikulare Funktion im bürgerlichen Musikleben" anklagte, "welches die falsche musikalische Arbeitsteilung hervorbrachte und sanktionierte ... Die so organisierte musikalische Arbeit wird zum Musterbeispiel entfremdeter Arbeit, bei welcher die Produzenten weder wissen, was sie produzieren, noch, warum, für wen und zu welchem Zweck sie produzieren." Beate Kutschke verweist auf die Zusammenhänge mit den Studentenunruhen, der Abkehr von allen verdächtigen Traditionen Nazideutschlands wie auch auf die Wechselwirkungen zur aufkommenden Bewegung der Jugend-, Rock- und Popkultur, die das negative Image der klassischen Musik befördert habe.
Hier befinden wir uns auf einem heiklen Punkt der Diskussion, denn weder können die angeführten Zitate bedeuten, Heavy Metal, Hard Rock, Rap oder Popmusik seien als Antipoden klassischer Musik zu verstehen, noch sind sie per se gut oder böse, nur weil sie ihrerseits gegen Traditionen aufbegehrt und sich durchgesetzt haben oder andererseits als Waffe oder Folterinstrument eingesetzt werden. Etwas pointiert würde ich von heute aus gesehen und zumal als Dirigent auch die Frage nach dem partikularen Rädchen im Getriebe eines 'bürgerlichen Musikbetriebes' stellen: Mit 100 Leuten Stravinskys Sacre zu erarbeiten, partnerschaftlich respektvoll und emotional überzeugend aufzuführen und zu interpretieren halte ich für weniger autoritär als den Auftritt einer Popband, die über zwei Stunden Tausende Menschen im Wesentlichen mit einer betonten Zwei und Vier in Trance zu versetzen sucht. Das Beispiel zeigt, dass diese Diskussion in die falsche Richtung führt und außerdem überholt ist. Gerade das Beispiel Barenboims und seines West-Eastern Divan Orchestras zeigt ja deutlich eine gegenläufige Tendenz und die Bedeutsamkeit eines Zusammengehens von
Autorität und
Authentizität im Musizieren und Handeln. Das oben entfaltete historische Panorama beweist, dass alle Musik, die uns heute als mächtig erscheint, im Geist der Auseinandersetzung entstand und nicht im Geist der Anpassung. Schütz und Nono sind Anfangs und vorläufige Zwischenpunkte einer beständigen Entwicklung und ihre Interpretation somit weit entfernt von einem 'Musterbeispiel entfremdeter Arbeit' – indessen gilt die Mahnung unvermindert, in der Ausbildung neue Wege zu suchen und nach dem Zweck dessen zu forschen, was wir tun.
Im von Stefan Gies herausgegebenen Band "Kulturelle Identität und soziale Distinktion" schreibt Ulrik Volgtsen in seinem Aufsatz "Identität, Authentizität und Qualität als Komponenten von Kultur": "Ohne eine nicht-institutionalisierte 'Graswurzelkultur' wäre die institulionalisierte 'Hochkultur' nicht in der Lage sich zu erneuern, sie würde im Dogmatismus erstarren und zum toten Kanon werden… Umgekehrt würde die nicht-institutionalisierte 'Graswurzelkultur' ohne eine institutionalisierte 'Hochkultur' ihre Richtung verlieren, ihre Funktion als nicht institutionalisierte ästhetische Gegenwelt. Ohne den Gegensatz zwischen Etabliertem und nicht Etabliertem würde auch die Unterscheidung zwischen hoch und niedrig im Sinne von Hochkultur und Massenkultur verloren gehen. Die Gesellschaft als Ganzes würde ihre Fähigkeit verlieren, sich über Werte zu definieren und sich mit einem Wertesystem zu identifizieren und am Ende ihres Reflexionsvermögens verlustig gehen."
Und eine zweite Abschweifung: Die mittlerweile an vielen Stellen veröffentlichten Studien (u.a. einer sogenannten Shell-Studie und der bekannten und häufig zitierten Bastian-Studie) über die Steigerung von Intelligenz, Reaktionsfähigkeit, emotionaler und sozialer Kompetenz von Kindern und Erwachsenen durch Musik lassen keinen Zweifel zu, dass die Macht der Musik kein Hirngespinst einer gebildeten bürgerlichen Mittelschicht ist, sondern ein nicht wegzudiskutierender Fakt. Der Hannoveraner Musikmediziner Eckart Altemüller antwortet auf die Frage, wie Musik Emotionen auslöst: "Das liegt daran, dass Musik wahrscheinlich ein uralter emotionaler Signalgeber ist. In der Musik stecken vermutlich Klänge und Laute drin, die unsere Vorfahren schon lange vor dem Spracherwerb als emotionalen Ausdruck verstanden haben: Seufzen, Lachen, Rufen und so weiter. Und das wurde dann in der Musik später ausgebaut, es wurde ritualisiert und hat dann zu einer Art von emotionaler Verständigung geführt." Und bereits in einem Artikel von Sarah Schelp aus dem Jahr 2008 für ZeitWissen heißt es: "Der renommierte amerikanische Kognitionspsychologe Howard Gardner … hält die musikalische Intelligenz für eine der wichtigsten Teilintelligenzen des Menschen. Die Welt der Töne befähigt Kinder, ihre Umgebung besser zu verstehen und sich anderen mitzuteilen. Musizieren lässt die Verbindungen zwischen den Nervenzellen beider Gehirnhälften besser wachsen, fördert Konzentration und Kommunikation. Dabei … ist es besonders wichtig, selbst aktiv zu werden, zu singen, ein Musikinstrument zu spielen."
Umso unverständlicher, wenn 2008 konstatiert werden musste, dass an deutschen Grundschulen 82% des Musikunterrichts ausfallen, Musiklehrer generell knapp sind, die Qualität des Unterrichts beständig sinkt und Musik als Laberfach gilt.
Und auch dies sollte uns eine Mahnung sein: "In den Genuss des bayerischen Staatsopernprojekts gelangen pro Jahr gerade mal vier Hauptschulklassen. Auch die spätestens seit dem Kinofilm Rhythm is it! boomende Musik-Eventkultur an Problemschulen erreicht selten mehr als 100 Schüler auf einen Schlag. In Deutschland gehen aber derzeit rund 9,5 Millionen Kinder und Jugendliche in die Schule – und das nicht projektwochenweise, sondern jeden Tag. Aktionen wie Oper.Über.Leben, [so heißt das erwähnte Projekt der Bayerischen Staatsoper] die School-Tour der Deutschen Phono-Akademie oder das Education-Programm der Berliner Philharmoniker können den regulären Musikunterricht nicht ersetzen. Sie sind trotz gut gemeinten Engagements nicht mehr als Appetithappen, die das eigentliche, vornehmlich strukturelle Problem ungewollt kaschieren. Diese »Events« – von den Politikern mit viel Applaus bedacht – bleiben oft nur schillerndes Versprechen auf ein Leben mit Musik."
Machen wir an dieser Stelle einen Punkt und fügen nur noch dies an: Das Deutsche Musikinformationszentrum nennt die aktuellen Zahlen (von 2012): "Insgesamt 3,8 Millionen Musizierende sind in den Verbänden des instrumentalen und vokalen Laienmusizierens zurzeit organisiert, rund 2,3 Millionen davon als aktive Sänger oder Instrumenta¬listen. Mit rund 750.000 Kindern und Jugendlichen macht der Anteil des musikalischen Nachwuchses rund ein Drittel aller aktiv Musizierenden aus." Etwa 1,4 Mill. Menschen werden privat oder an den 27.390 Musikschulen unterrichtet, 93% davon Kinder und Jugendliche – Tendenz steigend. Jenseits aller politischen Diskussionen und Entscheidungen haben die Menschen und erfreulicherweise auch die Kinder und Jugendlichen längst begriffen, was es mit der Macht der Musik auf sich hat – Schwierigkeiten in der Nachwuchsgewinnung und Qualität blenden wir dabei nicht aus.
Über solche und ähnliche Fragen wollen wir in den nächsten Tagen bei DMM 2014 diskutieren und ich freue mich sowohl auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle Kursdozentinnen und –dozenten wie auf alle Vortragenden, Disputierenden und Zuhörenden! Seien Sie alle von Herzen willkommen geheißen. Ich darf an dieser Stelle dem Vorbereitungsteam unter Leitung von Prof. Andreas Baumann ganz herzlich danken und erwähne stellvertretend für viele, die dahinter stehen Silke Fraikin, Stefanie Schwerk, Sibylle Hoppe, Dr. Katrin Bauer und Judith Storbeck, die wie immer mit zuverlässigster und engagiertester Unterstützung alles ermöglicht haben, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ich danke allen Sponsoren, ganz besonders der Kulturstiftung Dresden der Dresdner Bank und Ralf Suermann ganz persönlich für das hohe Engagement, der Drewag sowie dem DAAD, der zum wiederholten Mal die Alumni-Akademie möglich macht. Ich danke den Staatlichen Kunstsammlungen und Prof. Dr. Hartwig Fischer sowie Prof. Dr. Harald Marx, die Führungen möglich machen und selbst durchführen. Ich danke den Dresdner Neuesten Nachrichten, die mit einer intensiven Medienpartnerschaft erneut die DMM unterstützen und in einzelnen Artikeln unsere Gäste und Vorhaben vorgestellt haben.
All dies führt hoffentlich dazu, dass wir in den nächsten Tagen keine süße Brühe anrühren, sondern im Sinne Schnebels "die Wasser vorne, wo die Musik selbst ihren Lauf bahnt", kraftvoll statt kraftlos werden. Er zitiert als utopische Richtung künstlerischen Handelns Ernst Bloch, der den Gegensatz zur "Dummheit des Abklatsches" und den "Lügen der Schönfärberei" einfordert: "Schaffende Kunst ist eine, indem sie sowohl das Typisch-Bedeutende kenntlich macht, wie indem sie das ungeworden Mögliche im bewegt Wirklichen anfeuernd, ermutigend, als realistisches Ideal vorausgestaltet."
Ich darf deshalb abschließend die herausgefilterten Stichworte meines – wie betont: sehr persönlichen – historischen Panoramas nochmals ins Gedächtnis rufen:
Inhalt, Ernsthaftigkeit, Klarheit, Ehrlichkeit, Mystik, Inspiration, Kreativität, Entwicklung, Struktur, Wissenschaft, Objektivität, Abstraktion, Universalität, Phantasie, Erhabenheit, Rührung, Leidenschaft, Seele, Enthusiasmus des Geistes, Idealismus, Genialität, Originalität, Experiment, revolutionärer Aufbruch, Kontemplation, Lyrik, Melancholie, Einsamkeit, Einfachheit, Phantastik, Mythologie, Explosivität, Virtuosität, Offenheit, Liberalität, Demokratie, Struktur des Materials, Autorität, Authentizität ---
All dies könnte die Macht der Musik ausmachen und mit Karl Valentin würde ich an dieser Stelle verschmitzt hinzufügen: 'So einfach, und man kann sich's doch nicht merken'.
Wohlan – macht Musik! Ich danke Ihnen!
[im Original alle Zitate mit den entsprechenden Fußnoten und Verweisen - das ist hier nicht so einfach möglich, um Vergebung]