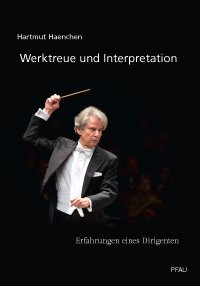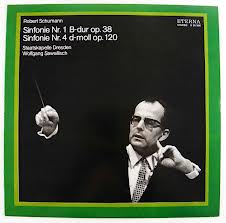[Gedanken, die ich heute bei einer Gedenkveranstaltung über meine Erinnerungen an die Zeit zwischen 1971 - 77 im Kreuzchor beisteuern sollte - Mosaiksteinchen, die von etlichen anderen Kollegen weitergeführt wurden. Das Bild stammt von Christoph Wetzel und wurde durch den Förderverein des Kreuzchores heute der Vergessenheit entrissen.]
Erinnerungen an Kreuzkantor Martin Flämig
zu seinem 100. Geburtstag
Meine erste Begegnung datiert von 1970 und ist eigentlich eher eine Erinnerung im Zusammenhang mit Rudolf Mauersberger. Dessen schlechter Gesundheitszustand hatte die Verantwortlichen bewogen, eine Nachfolgeregelung voranzutreiben. In diesem Zusammenhang gab es offensichtlich Gespräche mit Martin Flämig, der eines Tages zu einer Vesperprobe – meines Wissens an einem düsteren Freitagabend – auf einem der so wunderschön harten Holzstühle am Geländer der Chorempore saß. Ich entsinne mich einer gespenstischen, bedrückenden Atmosphäre. Mauersberger dirigierte, Flämig war uns kurz vorgestellt worden, m.E. sogar von Mauersberger selbst. Gerüchte machten die Runde. Dass mit der Anwesenheit eines möglichen Nachfolgers quasi offiziell beglaubigt wurde, die über 40-jährige Ära neige sich dem Ende zu, hat mich und viele andere merkwürdig berührt. Alle dachten: Aha, das soll wohl der neue Kreuzkantor werden? Es muss wohl an die 20 – 30 Minuten gegangen sein, als es aus Mauersberger herausbrach und er mit dem berühmten Krächzen klarstellte: "Ihr denkt wohl, ich sterb'? Ich sterb' noch lange nicht!"
Die letzten Monate unter Mauersberger verliefen alles andere als konfliktfrei. Wir standen auf dem Sprung und rechneten oft mit einem Zusammenbruch, wie es ihn bei einem Bachschen WO schon gegeben hatte (im Dezember 1968). Wir, das waren Olaf Bär, Egbert Junghanns, Andreas Göhler, Martin Schüler, Tilman Rau, Achim Zimmermann und alle, die mit uns damals in der Mitte der ersten Reihe standen – Soprane von 12 oder 13 Jahren… So sehr uns der Tod Mauersbergers mitgenommen hatte, empfanden wir deshalb den Amtsantritt von Martin Flämig als einen Aufbruch! Die Matthäus-Passion 1971 war vital, die ersten Proben verliefen inspirierend. Mit dem berühmten Rollkragen-Pullover (oft weiß, ich glaube, manchmal blau und selten schwarz; gelegentlich auch mit Hemd und Pullover) leitete Flämig die Proben vom Klavier aus, das später von Ulrich Schicha oder den Präfekten gespielt wurde. Er machte Atemübungen mit uns, neues Zeug, das wir nicht kannten… Irgendwann fiel der Satz: "Jongs, und wenn die Welt hinter Euch unterginge – Ihr habt Euch nicht umzudrehen!"
Der Spruch hingegen: "Jongs, wir singen einen Tonsatz von Adam Gumpelzhaimer" war weniger beliebt. Flämig schätzte die schlichten Stücke des "Geistlichen Chorlieds", des sogenannten 'Grotschi' außerordentlich, sie erklangen oft in Vespern und Gottesdiensten. Ihre Schlichtheit erschloss sich vielen nicht – fast schien es, die Kruzianer fühlten sich unterfordert: Eine anspruchsvolle Motette musste es schon sein! Es schwelte ein Konflikt, der sich in einer veritablen Aktion entlud, bei dem Teile des neu erworbenen Notenmaterials Tätlichkeiten überstehen mussten…
Schwieriger waren jedoch Auseinandersetzungen zu zwei Themen, die heute sicher ganz anders bewertet werden müssen als damals. Natürlich waren die Schweiz-Reisen des neuen Kantors relativ schnell Grund zu Konflikten. Ulrich Schicha war ein perfekter Assistent des Kreuzkantors und seine Arbeit kann gar nicht genügend gewürdigt werden. Dass ein Kreuzkantor allerdings überhaupt einen Assistenten benötigte und einsetzte und obendrein noch andere Ämter bekleidete – das war nach Mauersberger neu und Grund des Anstoßes. Alle drei Wochen fuhr Flämig mit seinem VW-Käfer in die Schweiz und kehrte meist Donnerstag/Freitag wieder zurück. Aus heutiger Sicht ist völlig klar, dass ein DDR-Bürger mit der Möglichkeit einer Arbeit im Westen diese Tür nicht verschloss. Er hat sie ganz sicher auch zum Besten des Kreuzchores genutzt.
Das zweite Thema war die Beeinflussung des Chores durch staatliche Stellen. Man trachtete danach, dem Kantor und der Kirche Macht abzunehmen und Gegenkräfte zu installieren, die in der Funktion des Direktors Richter und des Internatsdirektors Hönschel Gestalt gewannen. Es wäre sicher auch für die Forschung von Interesse, welchen Kämpfen Flämig ausgesetzt war. Ich kenne Erzählungen von einer Elternversammlung, bei der hinsichtlich einer geplanten Reise von Flämig Zugeständnisse erwartet wurden. Er sollte u.a. dafür bürgen, dass keiner der Jungs im Westen bliebe. Das hat er nicht getan und nach heftigen Wortwechseln die Versammlung verlassen. Meinem Vater nötigte die standhafte Haltung damals Respekt ab. Fakt ist, es gab bis 1977 keine West-Reise, sondern nur vergebliche Anläufe dazu. Meist hieß es im Sommer und Herbst, es sei etwas geplant, aber einmal kam der Zypern-Konflikt einer Griechenland-Reise in die Quere, ein andermal hieß es, der Chor hätte in Belgien in zu schlechten Unterkünften übernachten sollen – die Pläne fielen in sich zusammen und führten dazu, dass nach Weihnachten die Stimmung schnell sank. Die Disziplin ließ arg zu wünschen übrig und führte zu ernsthaften Problemen auch mit der Schallplatte. Nach den Schütz-Aufnahmen, den Bach-Messen, dem Weihnachts-Oratorium mit Martin Flämig ging es auf einmal nicht mehr weiter und es gipfelte in der Aufnahme von Volksliedern mit einer Art Pop-Gruppe. Das war sozusagen unter unserer Würde. Die Situation um 1975/76 war in der Tat sehr schwierig. Nach meinem Ausscheiden 1977 erhielt ich dann Postkarten aus Alicante und aus Japan – wir hatten versucht, das Ruder wieder etwas in die andere Richtung zu steuern.
Großen Eindruck hat Flämig bei mir hinterlassen mit dem Repertoire, das wir musiziert haben und durch seine emotionale Art, wie er es dirigierte. Nicht selten führte das zu sehr vitalen Interpretationen, bei denen der Eingangschor der Matthäus-Passion in breiten Achteln begann, um in doch recht flüssigen punktierten Vierteln zu enden… Unvergessen auch die ungekürzten WO-Aufführungen, bei denen die Güttlersche Trompete zu Beginn der Kantate 6 für ein erleichtertes Aufatmen im weiten Rund der Kreuzkirche sorgte. Das Brahms-Requiem unter Flämig war stets ein spannungsvoller Abend, neu hinzu kamen erstmals auch Dvořak und Verdi, was zu Fragen führte, ob das das richtige Repertoire sei. Viel mehr aber haben mich die neuen Dinge beeindruckt: Stravinskis Psalmensinfonie (zusammen mit Bach Magnificat und Udo Zimmermann Ode an das Leben) im Kulturpalast, Frank Martin (Requiem und In terra pax), Arthur Honegger (Weihnachtskantate und König David), Willy Burkhard (Die Sintflut), Heinrich Kaminski (Magnificat – mit der famosen Inge Uibel, die in höchsten Höhen trällerte). Und ich erinnere mich auch deutlich an einen Feuerreiter von Hugo Wolf und sogar Pfitzners Kantate Von deutscher Seele – man höre und staune. Das wurde – ich bitte die Musikwissenschaftler zu recherchieren – unter Flämig zu DDR-Zeiten in Dresden aufgeführt! Unvergessen auch eine unheimlich spröde Lukas-Passion eines schweizerischen Komponisten namens Richard Sturzenegger. Wir hatten sogar die Orchesternoten selbst geschrieben, die Kopien allerdings waren unleserlich; das Stück wurde abgesetzt und im Jahr darauf uraufgeführt – die Hoffnungen auf einen Ausfall waren umsonst. Gegen Ende meiner Kruzianerzeit entstanden gerade Auftragskompositionen, u.a. von Siegfried Köhler und Paul Dessau. Die 8-stimmigen Chöre nach Texten von van Gogh des Letzteren haben unsere Nachfolger uraufgeführt – wir durften in einer von Schicha geleiteten 'Präfektenstunde' die Komposition begutachten und damit offiziell 'abnehmen', damit Dessau sein Geld bekam.
Ich verdanke Martin Flämig sehr viel – die Prägung einer dem Neuen zugewandten künstlerischen Haltung gehört ganz besonders dazu. Auch die Grunddisposition, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen und Reibungsflächen nicht zu scheuen. Ich bin sicher, Flämig hat es den DDR-Oberen durchaus nicht einfach gemacht – allein dafür gebührt ihm tiefer Dank, den ich ihm kurz vor seinem Tod auch schriftlich überbracht habe. So ist mir seine Antwort von 1997 ein wertvolles Dokument und ein Zeichen der Verbundenheit. Daran, dass ich heute als Dirigent und Hochschulrektor hier stehe und spreche, hat er riesigen Anteil.
http://www.kreuzchor.de
http://www.kreuzchor.de/deutsch/foerderverein.php
http://www.foerderverein-kreuzchor.de